

Ihr Spezialist für kompetente Planung und sorgenfreies Bauen in Aschaffenburg und dem Rhein-Main Gebiet
- Holzhandwerk mit Tradition
- Über 100 Jahre Erfahrung im Holzbau
- Breites Spektrum vom modernen Holzhausbau bis zum Ingenieur-Holzbau und klassischen Zimmereiarbeiten
Hier bewerben
!

Bekommen Sie innerhalb von 2 Wochen ein Angebot
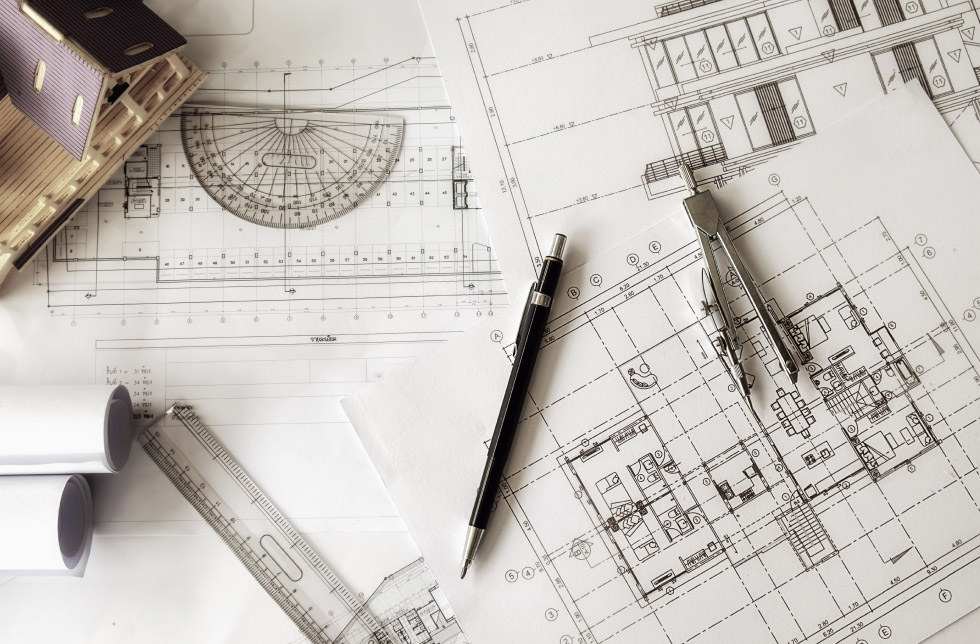

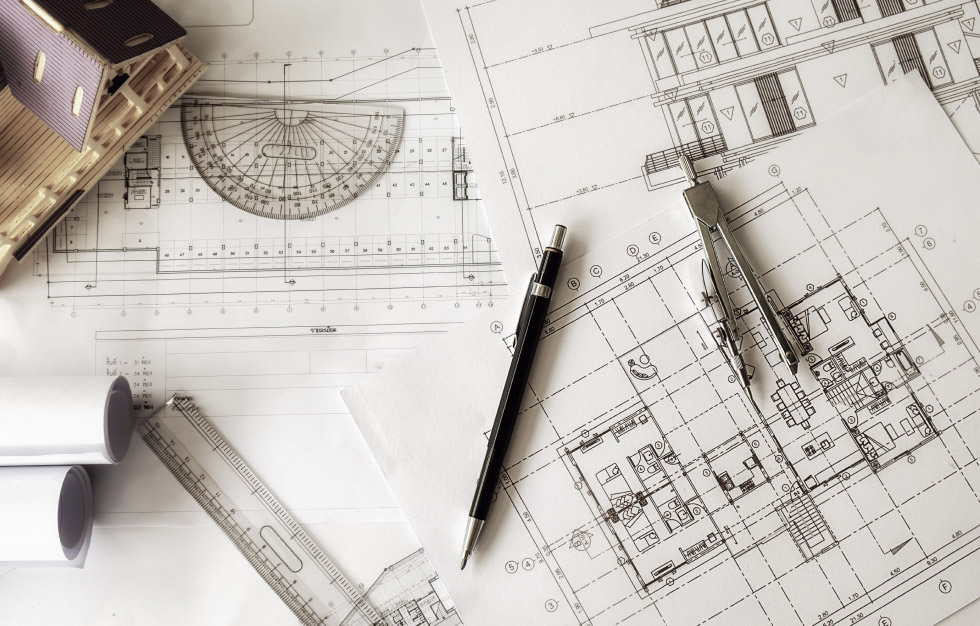
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wählen Sie aus folgenden Themenbereichen
Alles aus einer Hand
Schnell und kompetent in jeder Fragestellung
Professionell und zuverlässig



Kunkel Holzbau
Seit mehr als hundert Jahren wird in der Familie Kunkel mit Holz gearbeitet. Angefangen vom früheren Sägewerk bis zum heutigen Holzbaubetrieb – wir bauen auf Tradition.
Unser Spektrum reicht vom modernen Holzhausbau bis zum Ingenieur-Holzbau und klassischen Zimmereiarbeiten.
%
Jahre Erfahrung
%
renovierte Häuser
%
gebaute Häuser
%
beratene Kunden


Kundenmeinungen
Unsere Kunden empfehlen uns weiter
Absolut professionell!
Quelle: Google
Herr Kunkel hat die Aufstockung unseres Bungallows in absolute Professionalität ausgeführt. Wir sind von seiner Art - persönlich wie auch geschäftlich - begeistert und empfehlen ihn bedingungslos weiter! Vielen Dank nochmal!
Kundenorientierter Vorgehensweise
Quelle: Google
Ein Zimmereifachbetrieb mit großer Expertise und kundenorientierter Vorgehensweise. Absolut empfehlenswert!


Unsere Leistungen

Planung
- Anbau
- Aufstockung
- Neubau

Unterstützung
- Eigenleistung
- Baubeginn
- Begleitung der Bauarbeiten

Beratung
- Renovierung
- Sanierung
- Neubau


Sind Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Holzhausbauer?
Wenn ja, dann sind Sie bei Kunkel Hausbau genau richtig. Wir bieten Ihnen faire Preise und eine schnelle und einfache Abwicklung. Unser Team ist bestens ausgebildet und freut sich, Ihnen helfen zu können.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf und wir erstellen Ihnen einen unverbindlichen Kostenvoranschlag.






